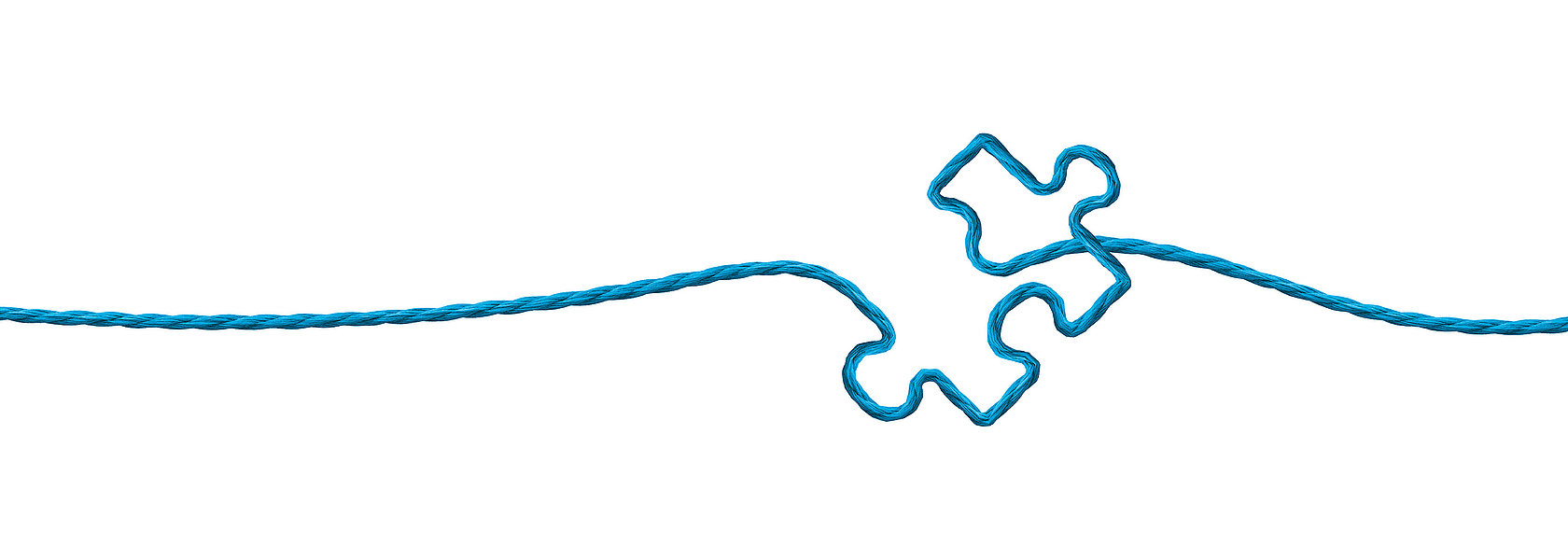
Gastbeitrag
Pflege als mehrteiliges Puzzle
Von Prof. Dr. Matthias Zündel

Über den Autor
Prof. Dr. Matthias Zündel ist Professor für Gesundheits- und Pflegemanagement an der Hochschule Bremen (HSB) und war bis Ende 2025 Leiter des Integrierten Gesundheitscampus Bremen. Zündels Arbeit fokussiert sich auf die Gestaltung zukunftsweisender Konzepte in Pflege, Gesundheit und Gesundheitsversorgung, die Förderung interdisziplinärer Kooperationen und den Wissenstransfer zwischen Hochschule, Praxis und Gesellschaft. Seine Expertise spiegelt sich sowohl in Lehrtätigkeiten, Publikationen und Forschungsprojekten als auch in seiner Rolle als Netzwerkpartner für regionale und überregionale Akteure und Akteurinnen im Gesundheits- und Pflegesektor wider.
Die zunehmenden Herausforderungen in unserem Gesundheitssystem werden seit Jahren breit diskutiert: seien es die Personalengpässe in allen Gesundheitsberufen, die anhaltende Debatte zur Professionalisierung vieler Gesundheitsberufe mit der Notwendigkeit, dann auch den Zuschnitt neu zu justieren, wer welche Aufgaben übernimmt und dafür dann auch die Verantwortung trägt. Die Frage einer auskömmlichen Finanzierung vor dem Hintergrund sich verändernder gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die das Feld der Qualität nicht außer Acht lassen kann und darf. Es ist schnell fundiert zu recherchieren, dass Deutschland immens hohe Gesundheitsausgaben hat, aber beispielsweise im Bereich der Lebenserwartung oder Effizienz nicht zu den Spitzenreitern gehört. Allein dieser Aspekt bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte und Diskussionstränge.
Chancen dank Datenbasis
Gehe ich in einen konkreteren Bereich der ambulanten Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf, dann ergeben sich aus meiner Perspektive Chancen im Zusammenspiel mit den Medizinischen Diensten. Diese sind unter anderem für die Feststellung von Pflegebedürftigkeit oder Höhergruppierungen von Pflegegraden verantwortlich. Sie erhalten damit einen nicht zu unterschätzenden Einblick in Versorgungsrealitäten, die sonst kein anderer hat – denn die meisten Menschen in Deutschland werden durch ihre Angehörigen versorgt und nicht durch professionelle Pflegedienste. Der MD erhebt dabei viele Daten, die aus meiner wissenschaftlichen Sicht, einen deskriptiven Schatz darstellen. Über diese Daten wäre in einer Stadt wie Bremen sehr genau darstellbar, in welchen Stadtteilen und sogar Straßen am meisten Pflegebedürftige wohnen. Über die Daten könnte man auch herausbekommen, wer die Hauptpflegeperson ist oder ob dies auf mehrere Personen aufgeteilt ist. Es wäre möglich darzustellen, ob der oder die pflegende Angehörige alleinlebt, mit jemandem in ihrem Haushalt, bei einem Partner oder einer Partnerin oder bei den Kindern, oder ob ein Kind vorbeikommt, oder, oder, oder … warum sind all diese Informationen ein Schatz? Diese Daten geben deskriptive Einblicke in Lebensrealitäten und können dabei helfen, passende Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige aufzubauen. Die Daten können aber auch genutzt werden, um beispielsweise im Rahmen einer Quartiersplanung zu überlegen, welche Angebotsstrukturen es in welchem Stadtteil vielleicht wirklich benötigt, wo es Sinn macht, verstärkt Beratungsangebote einzubringen, aufsuchende Arbeit aufzubauen etc., oder aber im Sinne einer Stadtentwicklung, welche Anreize geschaffen werden können, damit Stadtteile weiter durchmischt bleiben, Nachbarschaftshilfe sich entfalten kann etc. All das sind natürlich weitergehende politische Rahmungen, die gesetzt werden müssen – der MD könnte aber hierzu Daten liefern, um fundierte Versorgungssituationen aufzubauen.
Beratung dort, wo sonst niemand ist
Darüber hinaus sind die Mitarbeitenden des Medizinischen Dienstes zunächst häufig die ersten, die in solchen Haushalten vor Ort sind. Würde man hier Elemente weiterentwickeln und den MD stärker nutzen, um bereits Beratungen anzustoßen oder ganz konkrete Schulungen von pflegenden Angehörigen zu veranlassen, gäbe es immense Potenziale für die Sicherstellung von Qualität, gepaart mit einer passenden Angebotsstruktur. Dann wäre es evtl. eben nicht der von der Pflegekasse komplett bezahlte Kurs für pflegende Angehörige, sondern unter Umständen der gezielte Einsatz von zwei spezifischen Schulungsvideos und/oder ein ganz konkreter Schulungsbedarf in der Wohnung, beispielsweise zur Mobilisation des zu pflegenden Menschen.
Reise mit den Menschen vor Ort
An dem oben genannten Beispiel wird deutlich, welches ja zunächst auf das „Zahlenwerk“ des Medizinischen Dienstes eingeht, dass aus meiner Warte heraus – wenn Versorgung zukünftig gelingen soll – deutlich stärker informelle und formale Pflege- und Versorgungssettings miteinander verzahnt werden müssen. Es gibt immer noch häufig auf der Angebotsseite viele Dopplungen an der einen Stelle und woanders dann Leerstellen. Dabei gilt es, den Blick auf viele Stakeholder zu richten: beispielsweise im Bereich der Pflegeberatung, Nachbarschaftshilfe, Anbieter von Angehörigenkursen, Telefonangeboten, digitalen Tools, Pflegediensten etc. Die zu schaffenden Lösungen wären eher kleinräumig zu denken. Die Zahlen des Medizinischen Dienstes ermöglichen es, eine Basis aufzubauen, die man ergänzen könnte mit ganz konkreten Szenariotechniken. Denken wir an eine „idealtypische Pflegereise“ oder „Pflegenden-Angehörigen-Reise“, anhand derer sich konkret ableiten ließe, was, wo, wie gebraucht wird, um diese Dinge beispielsweise in den Quartieren zu entwickeln? Damit einhergehend wird klar, dass dieser Prozess zwar immer wieder angepasst und adaptiert werden müsste, aber die Chance böte – gerade vor dem Hintergrund auch von Personaldruck und Herausforderungen in der Versorgung – Doppel- oder Überangebote abzubauen und zugleich Versorgung und Qualität zu sichern. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Personaldruck und weiteren Herausforderungen in der Pflege ist dies ein attraktiver Gedanke.
Impulse von außen – das Fazit
Blicke ich auf die Aufgaben des Medizinischen Dienstes im Bereich der stationären Langzeitpflege, dann gibt es hier ja bereits erste Weiterentwicklungsansätze, beispielsweise bei Höherstufungen durch Mitarbeitende aus der Pflege oder wie jetzt in Bayern die Absprachen in Bezug auf Regelprüfungen zwischen der Heimaufsicht und dem Medizinischen Dienst. Der Medizinische Dienst hat in der Langzeitpflege unter anderem die wichtige Aufgabe, die Qualität der Pflege zu beurteilen. Das, was derzeit jedoch gemessen wird, ist für Träger „erlernbar“ und bildet damit nur bedingt das ab, worum es mir gehen würde. Ich selbst würde dafür votieren, über bestimmte Routinedaten zu versuchen, das Grundlevel der Qualität zu messen. Dies könnten beispielsweise Endpunkte sein wie: Wie lange leben Menschen dort durchschnittlich, wie häufig kommt es in einer Einrichtung zum Ausbruch bspw. von Durchfallerkrankungen und wie viele sind betroffen, die Sturzrate, die Rate an Krankenhauseinlieferungen, welche Wunden gibt es und wie häufig entstehen sie. Nicht „der eine“ Parameter würde alles darlegen, wäre aber ein Puzzlestein, aus dem sich ableiten ließe, ob es hier ein Qualitätsproblem gibt. Weitergehend ginge es um die ganz konkrete Begleitung von Menschen, die dort leben, und die Frage, wie hier im Alltag die Qualität gelebt und evtl. durch einen Medizinischen Dienst auch erlebt und reflektiert wird. Im Rahmen der PeBeM-Studie (Personalbemessung in der Pflege) wurden beispielsweise Beschattungen vorgenommen. Evtl. ließe sich hier etwas übertragen: Pflegemitarbeitende wurden über eine Schicht lang komplett von Mitarbeitenden des Medizinischen Dienstes begleitet, um zu dokumentieren, was den externen Gutachterinnen und Gutachtern auffällt. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen ziehen, beispielsweise wo die Hygiene nicht eingehalten wurde, wo es vielleicht Auffälligkeiten gab im Umgang mit Versicherten etc. Dies wäre eine zweite Ebene, die den Ansatz hätte, mit einem Blick von außen Impulse zu setzen, wo es Entwicklungsmöglichkeiten und -bedarfe gibt. Als Drittes ließen sich eventuell sehr spezifische Elemente – auch unter Hinzunahme der Angehörigen – vertiefen, beispielsweise in ganz konkreten und einfachen Fragen und Dimensionen wie „Haben Sie das Gefühl, Ihr Angehöriger/Ihre Angehörige hat zunehmend stärkeren Mundgeruch?“ oder „Haben Sie das Gefühl, Ihre Angehörige/Ihr Angehöriger riecht häufiger nach Urin?“ Darüber hinaus wäre es auch ein Ansatz, verstärkt die Angebotsstrukturen von sozialer Betreuung und Pflege in den Blick zu nehmen. Wie individualisiert sind hier Angebote, wie werden tatsächlich die Bedürfnisse von Bewohnerinnen und Bewohnern aufgenommen etc. Bei alldem würde es im Fokus deutlich stärker darum gehen, Verbesserungen und Weiterentwicklungen anzustoßen. Der MD wäre dann deutlich stärker als lösungsorientierte Beratung angelegt, im Rahmen eines Impulsgebers eines kontinuierlichen Verbesserungszyklusses. Ziel müsste es nicht sein, „Noten zu vergeben“, sondern das gemeinsame Interesse aller Beteiligten, ein gutes Lebensumfeld für Menschen zu gestalten, welche häufig hoch vulnerabel sind und nur noch bedingt für sich selbst eintreten können.
All diese Gedanken sind Impulse. Bereits beim Schreiben höre ich die inneren „Abers“ in mir, und einige von Ihnen werden diese auch sofort haben oder aussprechen. Gut so! Denn darum geht es. Aus meiner Perspektive ist eines klar: Um gesundheitliche Versorgung in Zukunft qualitativ weiter gewährleisten zu können, müssen sich alle Beteiligten neu justieren. Was dabei der richtige Weg ist, welche Impulse weiterzudenken und lohnenswert sind, obliegt nicht irgendjemandem allein. Dazu benötigt es den Diskurs und die „Abers“ in der Hoffnung, dass sich einige Ideen durchsetzen, erprobt und fundiert werden, um dann Eingang in den Pflegealltag zu finden.
